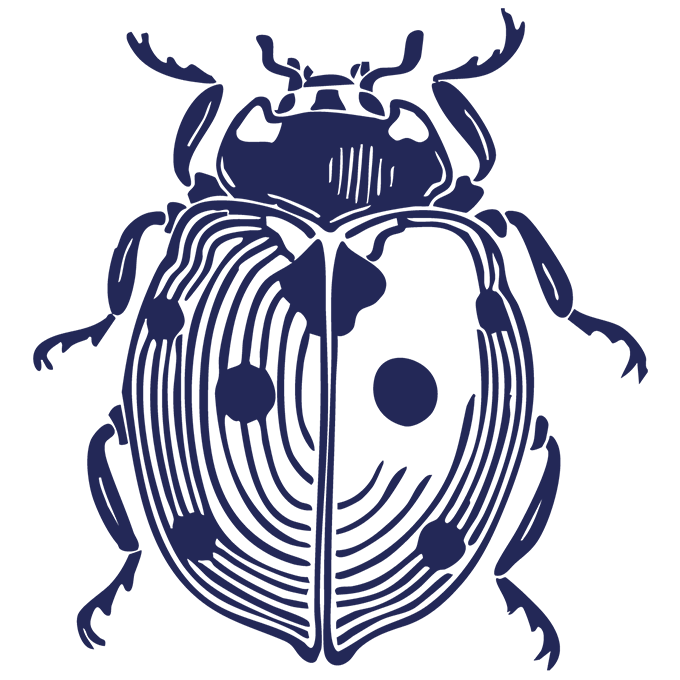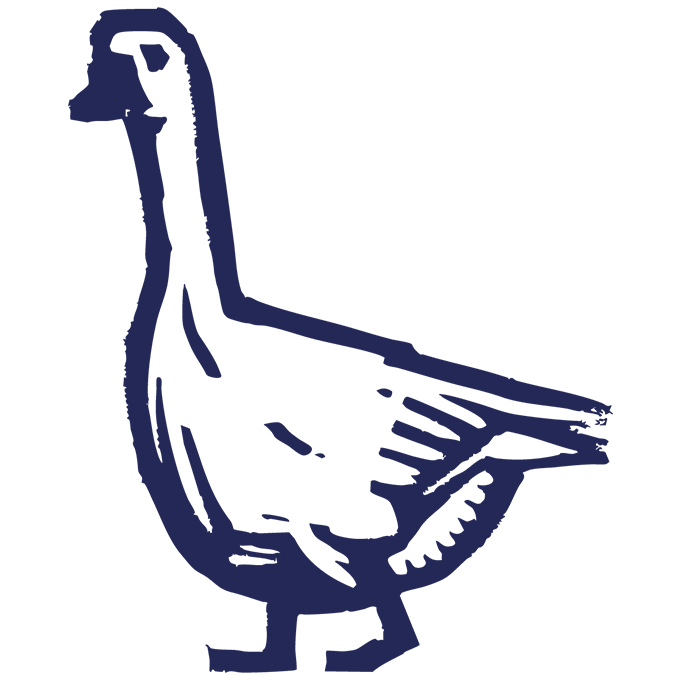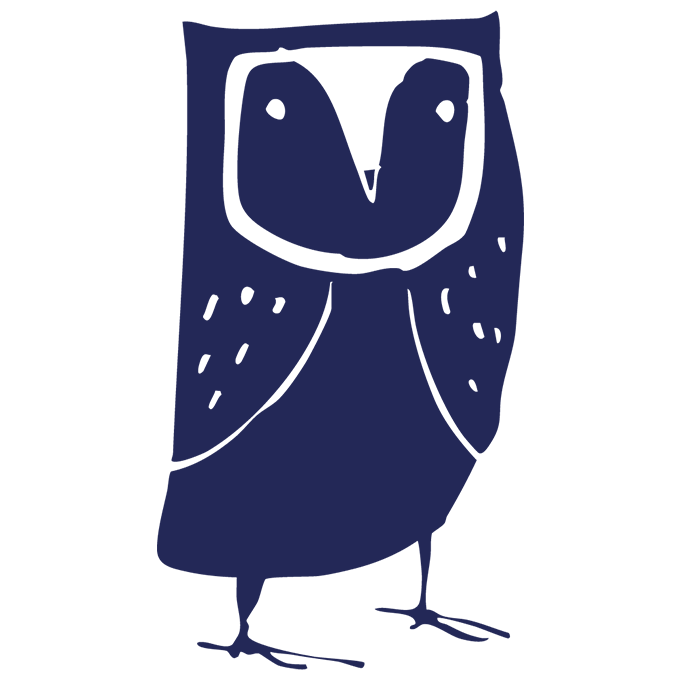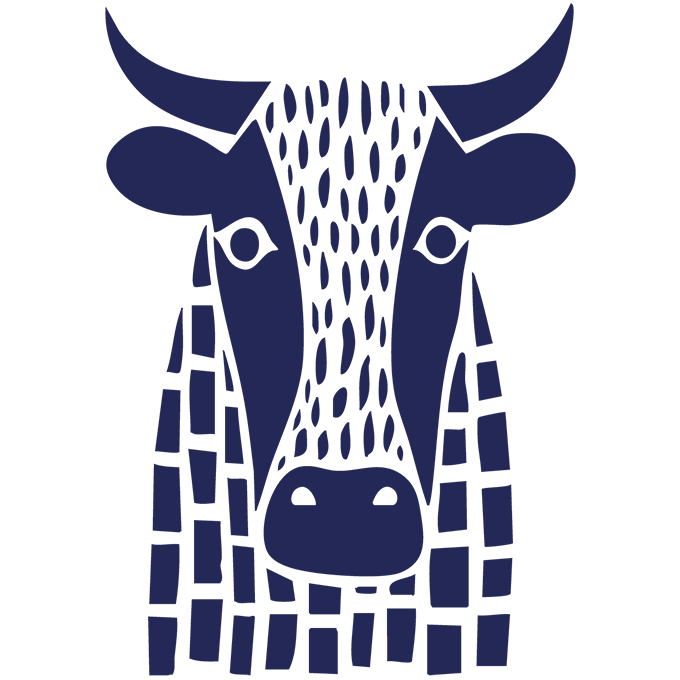BildungswegAlles unter einem Dach
Die Rudolf Steiner Schule Luzern (RSSL) umfasst alle Bildungsstufen, von der Spielgruppe bis zur Oberstufe, und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf verschiedene Wege vor, sei es eine Berufslehre, das Gymnasium oder andere individuelle Lebens- und Berufswege.
An der RSSL orientieren wir uns am Lehrplan der Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Gleichzeitig integrieren wir die Vorgaben des Lehrplans 21 in unsere pädagogische Praxis und bieten unseren Schülerinnen und Schülern damit eine umfassende Bildung, die sie bestmöglich auf ihren Lebensweg vorbereitet.
Schulangebot
AktivitätenMiteinander erleben, gestalten und feiern
-
Jede 8. Klasse studiert ein eigenes Bühnenstück ein, das in mehreren Aufführungen gezeigt wird. Kostüme, Kulissen und Requisiten werden von den Schüler*innen selbst gestaltet.
-
Jedes Schuljahr bringt besondere Lager wie Musik-, Pflanzenkunde- oder Sport-Lager mit sich.
-
Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, eine Woche lang in einem Beruf mitzuarbeiten – von der Bewerbung bis zum Abschlussgespräch sammeln sie wichtige Erfahrungen in einem beruflichen Umfeld.
8. Klasse
-
Während eines dreiwöchigen Praktikums übernehmen die Schüler*innen vielfältige Aufgaben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb – etwa im Ackerbau oder bei der Pflanzenpflege. Dabei lernen sie die Kreisläufe und die Komplexität der Landwirtschaft kennen und vertiefen ihr Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Mensch, Natur und Umwelt. Gleichzeitig werden soziale Kompetenzen wie Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein gestärkt.
9. Klasse
-
Von der 1. bis zur 12. Klasse bietet Eurythmie Raum, um den Körper als Ausdrucksmittel zu erfahren. Das Sommerspiel der 3. und 4. Klasse ist Highlight kurz vor den Sommerferien: Ein Naturspiel, in dem die Kinder in Rollen von Elementen und Naturwesen schlüpfen. Das Spiel wird mit Musik, Eurythmie, Tanz, Gesang und Sprache bereichert.
-
Musik, Gesang und das Erlernen eines Instrumentes begleiten die Schüler*innen und führen zu feierlichen Chor- und Orchesterauftritten.
Alle Klassen
-
Die Kinder verbringen regelmäßig Zeit in der Natur: Im Kindergarten und in der Unterstufe wöchentlich im Wald oder auf dem Bauernhof, in der Mittel- und Oberstufe im Schulgarten. Dort lernen sie den Umgang mit Erde, Tieren und Pflanzen, pflegen eigene Beete, schaffen Lebensräume für Tiere und Pflanzen und erfahren, wie unsere Nahrungsgrundlage entsteht.
-
An Jahresfesten erleben die Schüler*innen den Rhythmus des Jahres. Ob Michaeli, Weihnachten oder Johanni – jede Festzeit wird gefeiert und bereichert die Gemeinschaft.
-
Bei den Quartalsfeiern zeigen die einzelnen Klassen der Schulgemeinschaft, woran sie aktuell arbeiten.
-
Die Hermes Olympiade bringt Kinder verschiedener Klassen und Schulen zusammen, um Freundschaft, Fairness und Spielfreude über alle Grenzen hinweg zu erleben – stets mit Verantwortung für die Umwelt. Für dieses Engagement erhielt sie 2003 die Auszeichnung des Bundesamts für Wald und Landschaft (BUWAL) sowie den Swiss Olympic Prix Ecosport als ökologisch und pädagogisch wertvolle Sportveranstaltung.
Selbstgemachte Produkte
Aus einer lebendigen Gemeinschaft entstehen mit Kopf, Herz und Hand Produkte, in denen Schülerinnen der Rudolf Steiner Schule Luzern Kreativität, Sorgfalt und Handwerk verbinden.
Diese einzigartigen Stücke sind auch an unserem jährlichen Martini Markt zu erwerben – kommen Sie vorbei und entdecken Sie die Vielfalt!



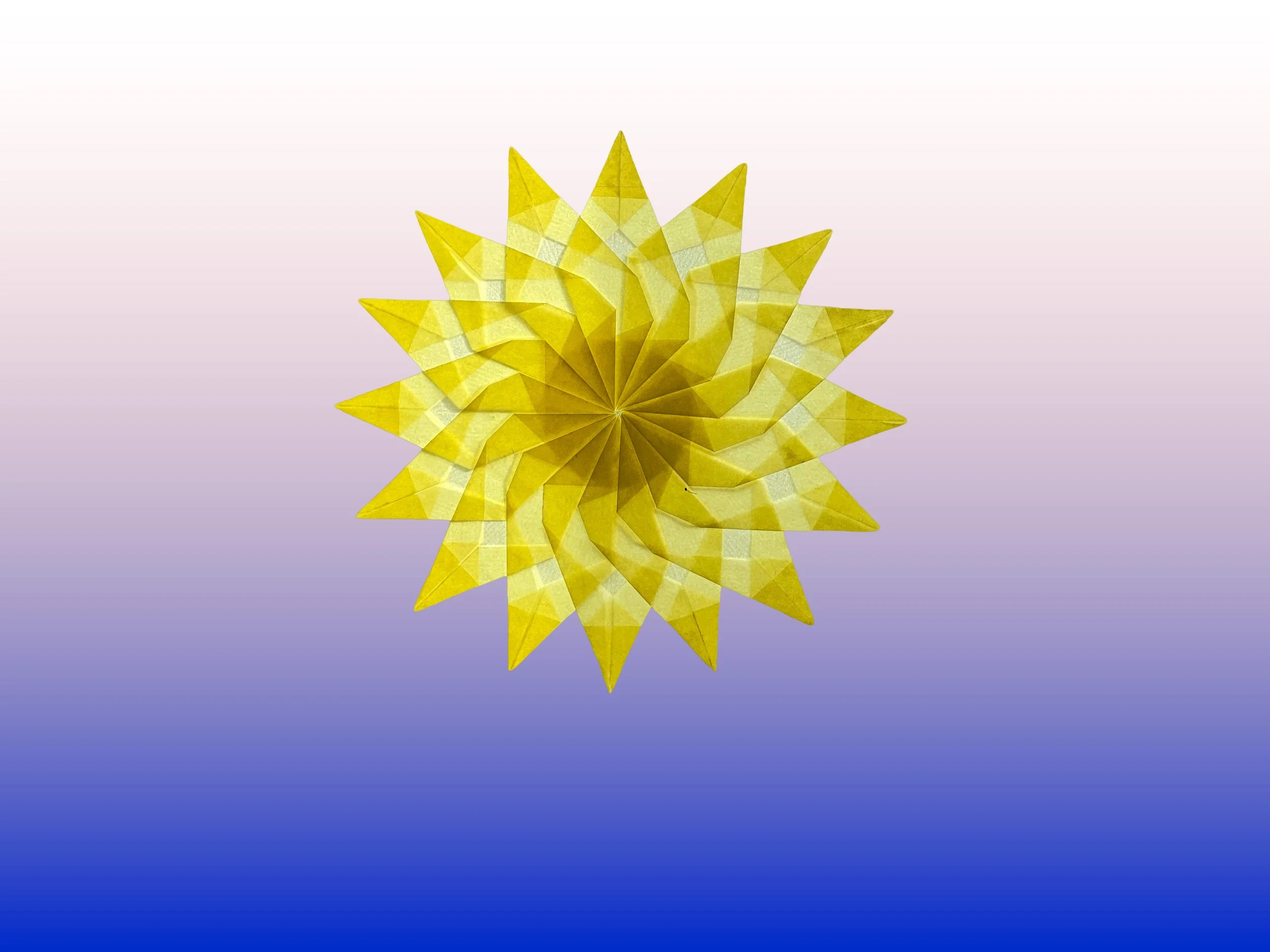


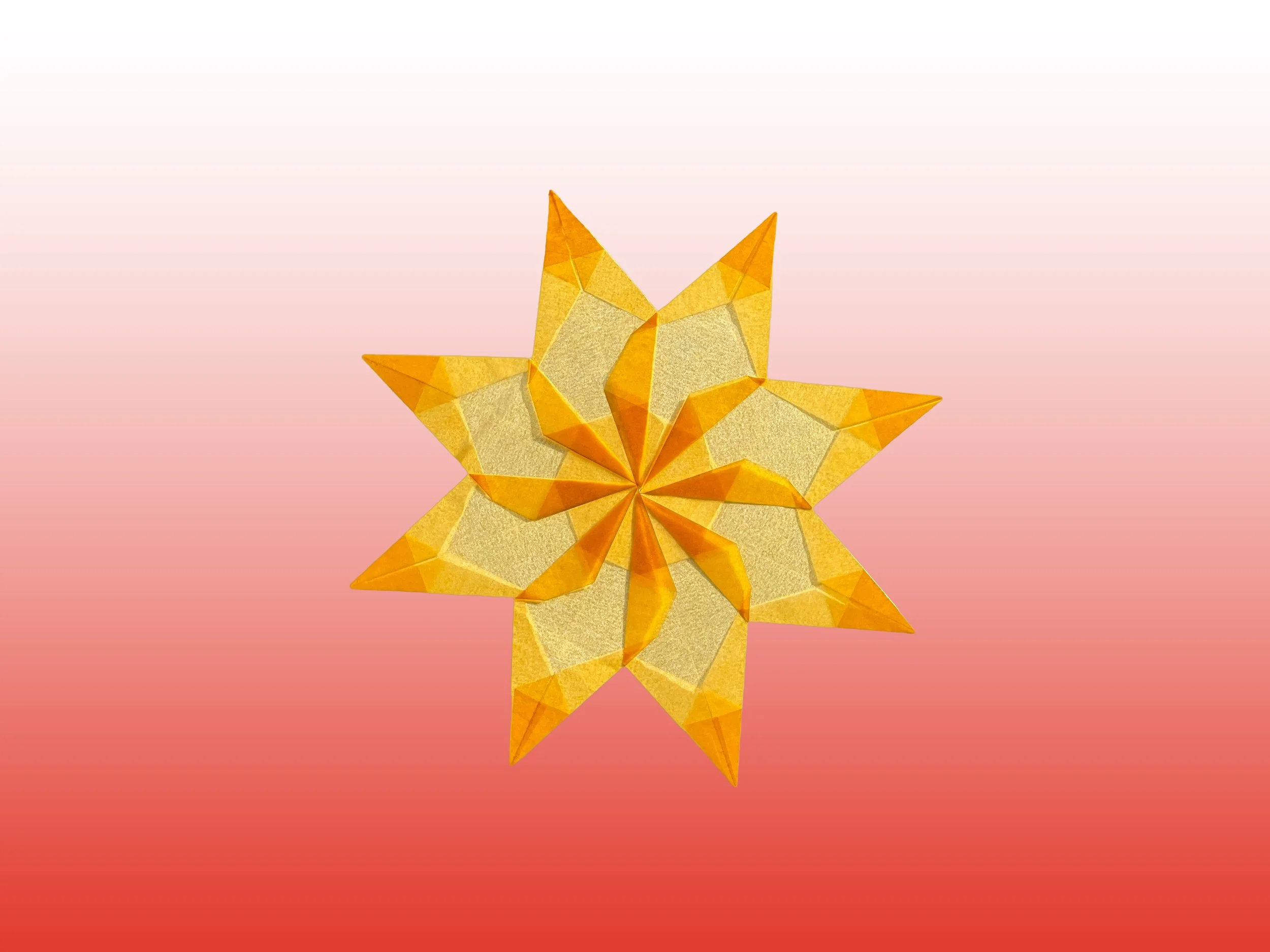


















































-
Waldorfschulen stehen grundsätzlich allen Kindern offen – unabhängig von Religion, ethnischer Herkunft und Weltanschauung der Eltern.
Euer Kind steht bei uns bereits im Aufnahmeverfahren im Zentrum. Die ein- bis zweiwöchige Schnupperzeit dient als gegenseitiges Kennenlernen und ermöglicht einen fliessenden Übergang von der bisherigen Schule an die RSSL. Parallel dazu finden Elterngespräche statt, in denen eure Fragen beantwortet und die organisatorischen Details geklärt werden.
-
Waldorfschulen entwickeln gleichermassen intellektuelle, kreative, künstlerische, praktische und soziale Fähigkeiten bei den Kindern und Jugendlichen .
Vom ersten Schuljahr an lernen Waldorfschüler:innen zwei Fremdsprachen. Jungen und Mädchen stricken, nähen und schneidern gemeinsam in der Handarbeit und sägen, hämmern und feilen zusammen im Werkunterricht. In der Oberstufe studieren sie ein anspruchsvolles Theaterstück ein und setzen sich in einer grossen Jahresarbeit mit einem Thema ihrer Wahl in Theorie und Praxis auseinander. Die an anderen Schulen unbekannten Fächer Gartenbau und Eurythmie sind feste Bestandteile des Lehrplans.
-
Rudolf Steiner ist der Begründer der Waldorfpädagogik. Emil Molt, Besitzer der damaligen Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, gründete mit ihm zusammen die erste Waldorfschule in Stuttgart. Inhalt und Methode der Waldorfpädagogik bauen auf Rudolf Steiners Erkenntnissen über die Gesetzmässigkeiten der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auf (“Allgemeine Menschenkunde”). Heute kümmert sich die “Arbeitsgemeinschaft der Steinerschulen in der Schweiz und Liechtenstein” (ARGE) um die stetige Aktualisierung und Weiterentwicklung des Rahmenlehrplans.
Neben der Pädagogik fanden Rudolf Steiners geisteswissenschaftliche Forschungen - er nannte sie Anthroposophie - auch Eingang in alle anderen Bereiche des Lebens, z.B. biologisch-dynamische Landwirtschaft (Demeter), die Anthroposophische Medizin (u.a. Weleda), Wirtschaft (Drogeriekette dm), die Kunst und vieles mehr.
-
Nein, die Waldorfschule ist eine Schule für alle junge Menschen. Die neuere Hirnforschung hat aber eindrucksvoll belegt, dass Kinder und Jugendliche durch künstlerisches Üben viele Kompetenzen erwerben, die weit über die unmittelbare Tätigkeit hinausreichen. Wenn Waldorfschüler:innen malen, zeichnen, plastizieren oder musizieren, geht es daher vor allem um die Schulung differenzierter Wahrnehmungen und die Entfaltung ihres schöpferischen Potenzials; die Begabungen der einzelnen Schüler:innen werden dabei natürlich berücksichtigt. Waldorflehrer:innen sind bestrebt, den Verstand, die Kreativität und die eigenständige Persönlichkeit ihrer Schüler:innen gleichgewichtig zu entwickeln.
-
Nein. Ausdrücklich nein. An Waldorfschulen lernen Kinder aller Begabungsrichtungen wie an den staatlichen Regelschulen auch, nur dass hier neben intellektuellen Fähigkeiten gleichgewichtig auch soziale und handwerklich-künstlerische Fähigkeiten Teil des Schulalltags sind.
Die individuelle Förderung von Kindern mit besonderem Assistenzbedarf ist eine wichtige Säule der Waldorfpädagogik, die entweder in speziellen Schulen mit einem inklusiven Konzept oder in heilpädagogischen Förderschulen umgesetzt wird.
-
Auch wenn Waldorfschulen in der Unter- und Mittelstufe auf Noten verzichten, werden die Schüler:innenarbeiten selbstverständlich gewürdigt. An Stelle der Noten stehen individuelle Beurteilungen, in denen die Lehrer:innen gleichermassen auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Lernfortschritte ihrer Schüler:innen eingehen. Es zählt also nicht allein der Wissensstand, sondern die Gesamtentwicklung in einem bestimmten Zeitraum. Waldorfschüler:innen lernen über die geamte Schulziet in einer stabilen Klassengemeinschaft, unabhängig vom angestrebten Schulabschluss: Niemand wird unterwegs Sitzengelassen.
-
Da der Waldorfunterricht sehr handlungsorientiert und auf die jeweilige Entwicklungsphase der Schüler:innen abgestimmt ist, stellt sich diese Frage nur selten. Eigeninitiative entwickeln die Kinder und Jugendlichen nicht aufgrund von äusserem Leistungsdruck, sondern aus lebendigem Interesse und persönlicher Begeisterung für die vielfältigen Unterrichtsinhalte. Diese gestaltet die Lehrkraft kreativ und lebensnah, sodass sie sich an der persönlichen Erfahrungswelt der Kinder orientieren und ihnen eigene Erlebnisse vermitteln. Waldorflehrer:innen bereiten sich auf diese anspruchsvolle pädagogische Tätigkeit unter anderem an eigenen Seminaren und Hochschulen vor.
-
Die Praxis zeigt, dass gerade Waldorfschüler:innen von Ausbilder:innen besonders geschätzt werden. Zudem bringen verfügen sie über eine Überdurchschnittliche Resilienz in allen Lebensbereichen.
In einer Schule, die nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten anspricht, entwickeln sich Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Kreativität und die Fähigkeit, prozessual zu denken, vom ersten Schultag an. Umfangreiche Absolvent:innenstudien zeigen, dass Waldorfschüler:innen in allen Studien- und Berufsfeldern sehr erfolgreich studieren und arbeiten.
-
Alle. Da die einzelnen Bundesländer jeweils eigene Schulgesetze haben, gibt es zwar Unterschiede, aber grundsätzlich gilt, dass an einer Waldorfschule die üblichen staatlichen Abschlüsse erworben werden können: Haupt- und Realschulabschluss ebenso wie das Abitur und meistens auch die Fachhochschulreife. Am Ende des zwölften Schuljahres (an einigen Schulen am Ende der elften Klasse) bieten zahlreiche Waldorfschulen einen eigenen Waldorfschulabschluss an, der ihren Schüler:innen Gelegenheit gibt, neben den Prüfungsfächern der staatlichen Abschlüsse ihre individuell erworbenen Kompetenzen zu präsentieren. Das dreizehnte Schuljahr dient in der Regel der gezielten Vorbereitung auf Abitur/ Fachhochschulreife.
-
Ja und nein. Es ist ein Prinzip der Waldorfschulen, kein Kind aus finanziellen Gründen abzulehnen. Da im Kanton Luzern privat geführte Schulen keine Unterstützung von Staat erhalten, ist auch die Rudolf Steiner Schule zu 100% über Elternbeiträge finanziert. Diese sind einkommensabhängig. Wir sind bemüht, den Mindestbeitrag durch verschiedenste Massnahmen so tief wie möglich zu halten.
-
Während der ersten beiden Stunden eines Schulvormittags arbeitet die Klasse über mehrere Wochen intensiv an jeweils einem Fachgebiet. So haben sie zum Beispiel drei Wochen lang jeden Morgen zwei Stunden Mathematik, Geografie, Deutsch, Geschichte oder ein anderes Hauptfach. Nach einigen Wochen wechselt der Inhalt der Epoche zu einem anderen Thema, sodass die Schüler:innen sich intensiv damit verbinden. Grundfertigkeiten wie Rechnen oder Schreiben festigen die Schüler:innen über den Epochenunterricht hinaus in fortlaufenden Übstunden. Im Anschluss an den Epochenunterricht gibt es Fachstunden in Sport, Fremdsprachen, Eurythmie, Musik und in den handwerklich-künstlerischen Fächern.
-
Die Klassenlehrer:innen decken tatsächlich ein grosses Spektrum an Fächern ab. Vor allem in den unteren Klassen. In besonderen Ausbildungswegen, die sie in einem Vollstudium oder postgraduiert im Anschluss an eine wissenschaftliche oder pädagogische Ausbildung an der Akademie für anthroposophische Pädagogik in Dornach (AfaP) oder einer vergleichbaren Ausbildung im Ausland durchlaufen, werden sie gezielt darauf vorbereitet. Für Klassen-, Fach- und Oberstufenlehrer:innen gilt gleichermassen, dass ihre Ausbildung mindestens gleichwertig zur staatlichen Ausbildung sein muss. In der Unter- und Mittelstufe liegt der Schwerpunkt allen Lernens nicht nur auf der Vermittlung reinen Fachwissens, sondern es geht auch darum, den Schüler:innen eine lebendige, erfahrungsgesättigte Beziehung zu den Lerninhalten zu ermöglichen. So kann Lernen Freude machen – ein Leben lang.
-
In der Oberstufe unterrichten in allen Fächern akademisch oder handwerklich ausgebildete Lehrer:innen die Jugendlichen. Die praktischen Fähigkeiten, die die Schüler:innen sich über die gesamte Schulzeit hinweg angeeignet haben, finden nun Ergänzung durch Praktika: In einem Landwirtschafts-, Forst-, Vermessungs-, Betriebs- und Sozialpraktikum erhalten die jungen Menschen eine lebensnahme Ausbildungsgrundlage. Der eigentliche Sinn der Praktika liegt nicht in der Berufsfindung, sondern vor allem im Erüben wichtiger sozialer Fähigkeiten.
-
Nein. Die von Rudolf Steiner entwickelte Anthroposophie ist eine Erkenntnishilfe für die Lehrer:innen, zu keinem Zeitpunkt aber ist sie Gegenstand des Unterrichts. Unser Ziel ist es, die Kinder zur grösstmöglichen Freiheit im Denken und zu einem gesunden Selbstbewusstsein im eigentlichen Wortsinn zu begleiten.
-
Eurythmie (wörtlich: guter, auch schöner Rhythmus) ist eine Bewegungskunst, die an Waldorfschulen in allen Klassen unterrichtet wird. Im Unterschied zu gymnastischen, pantomimischen oder tänzerischen Bewegungen, die völlig frei gestaltet werden können, gibt es in der Eurythmie für jeden Sprachlaut und jeden Ton eine ganz bestimmte Gebärde – es handelt sich also um sichtbar gemachte Sprache und Musik. In der Lauteurythmie stellen die Schüler:innen zum Beispiel dar, was in einem Gedicht an Lauten lebt, und in der Toneurythmie, was in den Tonintervallen einer musikalischen Komposition lebt.
-
Der naturwissenschaftliche Unterricht stützt sich zwischen dem vierten und achten Schuljahr auf das präzise Beobachten biologischer, physikalischer und chemischer Phänomene und auf das selbstständige Entdecken der jeweiligen Gesetzmässigkeiten. Vom 9. Schuljahr an treten abstrakte Modellvorstellungen und die Begriffsbildungen der modernen Naturwissenschaften in den Vordergrund, wobei weiterhin ein ergebnisoffener, forschender, auf eigenen Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen beruhender Unterricht praktiziert wird. Eine in Österreich durchgeführte PISA-Studie zu den Naturwissenschaften bescheinigt Waldorfschüler:innen weit überdurchschnittliche naturwissenschaftliche Kompetenzen und führte dies ausdrücklich auf die als vorbildlich bezeichneten phänomenologischen Unterrichtsmethoden zurück.
-
Medienpädagogik ist fester Bestandteil im Lehrplan der Waldorfschulen. Sie beginnt zunächst als eine "indirekte Medienpädagogik", bei der die jüngeren Kinder die Welt mit allen Sinnen erfahren und sich kreativ und fantasievoll anhand unterschiedlicher Materialien mit ihr auseinandersetzen. Umfassende Erfahrungen mit analogen Medien sind eine grundlegende Voraussetzung, damit die Schüler:innen die Urteilsfähigkeit entwickeln, für den selbstständigen Umgang mit digitalen Medien.
Bei uns werden die diese ab der 7. Klasse Schritt für Schritt in den Unterricht eingeführt, wobei neben der praktischen Handhabung unter anderem ein echtes Verständnis der technologischen Grundlagen und Funktionsweise des Internets wichtig wird. Dieses reicht in der Oberstufe bis zu Reflexion der weltweiten gesellschaftlichen Wirkungen dieser Technologien und führt zu einem mündigen Umgang mit digitalen Medien und zukünftigen Entwicklungen.
-
In der Schweiz gibt es fast überall eine Steinerschule in erreichbarer Nähe. Jede Waldorfschule wird sich darum bemühen, Waldorfschüler:innen nach einem Umzug aufzunehmen. Ein Wechsel von und zu staatlichen Regelschulen bedeutet zwar eine Umstellung, ist aber möglich und keine Seltenheit. Falls ein Umzug ins Ausland zum Thema wird: Weltweit gibt es – mit deutlich steigender Tendenz – über 1.200 Waldorfschulen. Damit sind die Waldorfschulen die größte überkonfessionelle und nicht staatliche pädagogische Bewegung der Welt.
FAQ